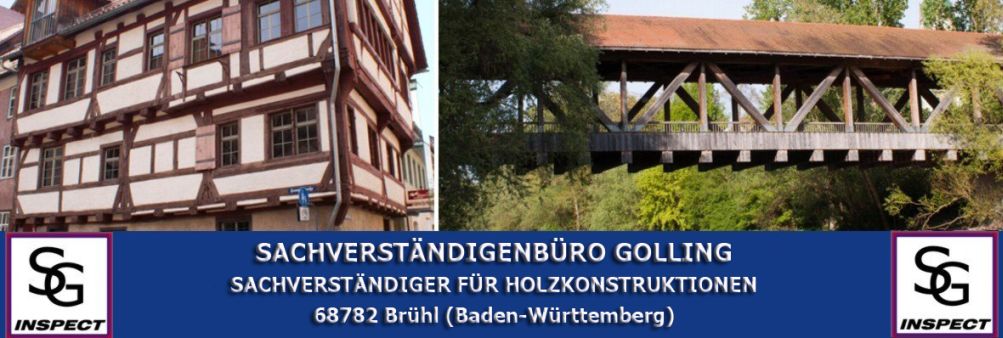Holzkorrosion / Mazeration
 Mazeration (auch oft als Holzkorrosion bezeichnet) ist ein nicht allzu häufiger Schaden.Er ist den sog. chemischen Schäden zuzuordnen. Mazeration entsteht, wenn sich an der Holzoberfläche durch das Zusammenspiel von salzhaltigen Holzschutzmitteln -im speziellen Brandschutzanstriche- oder Tierkot von Fledermäusen oder Vögeln Säuren bilden, die das Lignin im Holz auflösen. Es ist also kein biologischer Prozess, sondern eine chemische Reaktion. Auch Ziegeleindeckungen können im Zusammenspiel mit entprechender Luftfeuchtigkeit dazu führen, wenn sich mineralische Salze aus den Dachziegeln oder dem Verstrichmörtel lösen und sich als feiner Säurefilm auf dem Holz absetzen. Erkennbar ist die Holzmazeration daran, daß an der Oberfläche bis ca 1,5 cm Tiefe das Holz watteartig zerfasert ist. Häufig geht diese Zerfaserung mit einem kristallinen Ausblühen der Salze einher. Zu einer starken Schädigung kann Holzmazeration dann führen, wenn sich große Mengen von zersetzender Säure bilden wie es beispielsweise der Fall ist, wenn über Jahre dicke Schichten von Fledermauskot auf den Hölzern haften.
Mazeration (auch oft als Holzkorrosion bezeichnet) ist ein nicht allzu häufiger Schaden.Er ist den sog. chemischen Schäden zuzuordnen. Mazeration entsteht, wenn sich an der Holzoberfläche durch das Zusammenspiel von salzhaltigen Holzschutzmitteln -im speziellen Brandschutzanstriche- oder Tierkot von Fledermäusen oder Vögeln Säuren bilden, die das Lignin im Holz auflösen. Es ist also kein biologischer Prozess, sondern eine chemische Reaktion. Auch Ziegeleindeckungen können im Zusammenspiel mit entprechender Luftfeuchtigkeit dazu führen, wenn sich mineralische Salze aus den Dachziegeln oder dem Verstrichmörtel lösen und sich als feiner Säurefilm auf dem Holz absetzen. Erkennbar ist die Holzmazeration daran, daß an der Oberfläche bis ca 1,5 cm Tiefe das Holz watteartig zerfasert ist. Häufig geht diese Zerfaserung mit einem kristallinen Ausblühen der Salze einher. Zu einer starken Schädigung kann Holzmazeration dann führen, wenn sich große Mengen von zersetzender Säure bilden wie es beispielsweise der Fall ist, wenn über Jahre dicke Schichten von Fledermauskot auf den Hölzern haften.

Eventuelle biologische Verunreinigungen durch Tierkot sollten entfernt werden oder die entprechenden Lacke durch Sandstrahlen abgetragen und durch Alternativen ersetzt werden. Auch eine Änderung der bauphysikalischen Umstände kann zu einer Verlangsamung oder einem Stoppen der Holzkorrosion führen.
Mechanisch bedingte Schäden an Holzkonstruktionen
Mechanische Schäden können vielerlei Ursachen haben. Zum einen sind sie eine Konsequenz aus Insekten- und Holzfäuleschädigungen die die statische Belastbarkeit soweit heruntergesetzt haben, daß es zur Verformung oder zum Bruch kommt, zum anderen liegen die Ursachen aber auch in externen Krafteinwirkungen begründet. Ein solcher Fall ist zum Beispiel ein Anfahrschaden wie er manchmal an Holzbrücken zu beobachten ist oder eine Absenkung des Fundaments was eine Lastumverteilung in der Gesamtkonstruktion bewirken kann.
Vielfach ist die Ursache für einen mechanischen Schaden aber in einer Überlastung zu suchen, bei der das Holz der einwirkenden Kraft nicht mehr standhalten kann. Dies kann eine Erhöhung der ursprünglichen Nutzlast über das zulässige Maß hinaus sein oder aber eine schon wärhend der Bauphase falsche Berechnung, wie es bei historischen Gebäuden manchmal zu beobachten ist und ganze Fachwerkhäuser unter dem eingebrachten Gewicht nachgeben.

Die Kenntnis der Lage und des Ausmaßes solcher mechanischer Schäden ist äußerst wichtig, da sich ein Schwachpunkt auf andere Bauteile auswirken kann und im schlimmsten Fall der Einsturz droht. Daher werden bei einer Untersuchung der Holzkonstruktion nicht nur Fäule- oder Insektenschäden in die Zustandskartierung übernommen, sondern auch beobachtete mechanische Schäden, um alle Schwachstellen zu erkennen und um Gegenmaßnahmen einzuleiten.
Fäuleschäden durch holzzerstörende Pilze
Holzzerstörende Pilze sind das Hauptschadensbild in Bauwerken. Ursächlich hierfür ist immer ein erhöhter Feuchtigkeitsgehalt der Hölzer und deren umgebende Bauteile. Eine Undichtigkeit am Dach oder in der Sanitärinstallation, die längere Zeit unentdeck geblieben ist, bilden oft die Grundlage.
Holzzertörende Pilze sind mit ihren Sporen in unserer Umgebungsluft allgegenwärtig. Nur wenn sie die artspezifisch idealen Bedingungen vorfinden besiedeln sie das Holz und beginnen ihr zerstörerisches Werk.
 In der freien Natur ist es die Aufgabe der Pilze totes Holz zusammen mit Insekten und Bakterien wieder in Biomasse umzuwandeln und so dem Kreislauf der Natur wieder zuzuführen. Im Bauwerk ist das aber nicht gewünscht und führt zu großen Schäden, die im schlimmsten Fall den Einsturz des Bauwerks zur Folge haben.
In der freien Natur ist es die Aufgabe der Pilze totes Holz zusammen mit Insekten und Bakterien wieder in Biomasse umzuwandeln und so dem Kreislauf der Natur wieder zuzuführen. Im Bauwerk ist das aber nicht gewünscht und führt zu großen Schäden, die im schlimmsten Fall den Einsturz des Bauwerks zur Folge haben.
Die Schädigungen der unterschiedlichen Holzpilze sind stark von der Pilzart und den Faktoren abhängig, unter denen sie wachsen. Manche Pilzarten haben bevorzugte Hölzer die sie befallen und richten ihr Wachstum nach den vorhandenen Umweltbedingungen aus. Zwei direkt nebeneinander liegende Balken der selben Holzart und des selben Alters können ganz unterschiedlichen Befall aufweisen. Unter optimalen Bedingungen kann das Pilwachstum in einem Konstruktionsholz mehrere Meter im Jahr betragen und im Umfeld verbaute Hölzer können angesteckt werden.
Prinzipiell können holzzerstörende Pilze in drei Kategorien eingeteilt werden:
Die sogenannte Braunfäule, die die Zellulose im Holz abbaut und dunkle braune Holzreste mit würfeligen Bruchkanten hinterläß.
Des weiteren die sogenannte Weißfäule, die zusätzlich das Lignin abbaut und helle weiche Zellulosefasern übrig läßt. Diese beiden Fäuletypen sind die Hauptzerstörer von Holz.
Die dritte Kategorie sind Moderfäulepilze, die eigentlich zu den Schimmelpilzen gehören und eine sehr hohe Holzfeuchte benötigen mit der Zeit aber ebenfalls die Holzsubstanz abbauen.

Für eine Hausschwamm-Sanierung gibt es autorisierte Fachunternehmen. Vor einer Sanierung des Hausschwamms nach DIN 68800-4 muß aber eine genaue Feststellung des Befallsausmaßes und der Ursachen erfolgen.
Der Artenreichtum holzzerstörender Baupilze ist vielfältig. Um Schädigungen der Bausubstanz aufzuhalten und weitere zu verhindern, ist die Bestimmung der Pilzart notwendig. Auch die Ursachen für den Pilzbefall (z.B. erhöhte Feuchtigkeit und deren Ursprung sowie exponierte Angriffsflächen speziell im Aussenbereich) müssen gefunden und beseitigt werden.
 Meist ist schon ein größerer Schaden entstanden wenn der Pilz durch Fruchtkörper sichtbar wird. Holzzerstörende Pilze wachsen zuerst im Inneren der Hölzer, wo genügend Feuchtigkeit vorhanden ist und sie windgeschützt sind.
Meist ist schon ein größerer Schaden entstanden wenn der Pilz durch Fruchtkörper sichtbar wird. Holzzerstörende Pilze wachsen zuerst im Inneren der Hölzer, wo genügend Feuchtigkeit vorhanden ist und sie windgeschützt sind.
Vielfach ist eine Schädigung der Hölzer über den visuell erkennbaren Bereich hinaus vorhanden. Eine augenscheinlich intakte Schnittfläche kann daher dennoch eine Festigkeitsminderung haben, die statisch relevant ist und auch Reste des Pilzes beinhaltet.
Eine solche Schädigung läßt sich mittels hochauflösender elektronischer Resistograph®- Bohrwiderstandsmessungen feststellen. Eine Aussage über die Befallsausdehnung ist ebenso wichtig wie eine fachkompetente Laboruntersuchung des Fäuleerregers und kann somit zu einer soliden Sanierungsplanung entscheidend beitragen.
Weiter zu Insektenschäden
,
Insektenschäden an Bauhölzern
Ein vielfach beobachtetes Schadensbild an Konstruktionshölzern ist der sogenannte Insektenfrass. Sehr oft sind speziell in älteren Dachstühlen ovale oder kleine runde Bohrlöcher zu beobachten, die teilweise mit kleine Holzmehlhäufchen auf der darunter befindlichen Fläche auftauchen. Hierbei handelt es sich um holzzerstörende Insekten, die im Holz ihre Eier ablegen und deren Larven sich bis zu ihrer Entwicklung zum adulten Käfer durch das Holz fressen. Dieser Prozess kann je nach Insektenart über Jahre dauern und ist von verschiedenen Faktoren abhängig wie beispielsweise Temperatur, Holzfeuchte und Nährstoffgehalt des jeweiligen Holzes.
 Nicht jedes Holz wird befallen, aber entgegen der älteren Lehrmeinung ist das Alter der verbauten Hölzer zweitrangig. Es weisen mitunter auch Hölzer frischen Insektenbefall auf, die schon seit 200 Jahren verbaut sind.
Nicht jedes Holz wird befallen, aber entgegen der älteren Lehrmeinung ist das Alter der verbauten Hölzer zweitrangig. Es weisen mitunter auch Hölzer frischen Insektenbefall auf, die schon seit 200 Jahren verbaut sind.
Holzzerstörende Insekten benötigen immer bestimmte Bedingungen für einen Befall des Holzes. Hierzu gehören unter anderem ein bestimmtes Temperaturspektrum sowie entsprechende Holzfeuchte. Auch ist der Nährstoffgehalt der Hölzer und die Oberflächenbeschaffenheit wichtig.
Prinzipiell kann man holzzerstörende Insekten in 2 Kategorien unterteilen: Die Insekten, die bereits den lebenden Baum in der Natur befallen und ihn verlassen bzw. absterben, sobald er gefällt und zu Bauholz verarbeitet ist und Insekten, die sich erst in totem Holz oder Bauholz einnisten.
Hier treten 4 Arten sehr häufig hervor: Der "Gemeine Hausbock" (Hylotrupes bajulus), der "Gemeine Nagekäfer" (Anobium punctatum), der im Volksmund auch als "Holzwurm" bezeichnet wird, der "Gescheckte Nagekäfer" (Xestobium rufovillosum) und der "Trotzkopf" (Hadrobregmus pertinax).
Der "Gemeine Hausbock" (Hylotrupes bajulus)
Der Hausbock wird oft erst bemerkt, wenn die Larven sich im Holz bereits zu Käfern entwickelt haben und ausgeflogen sind, da er im lebenden Befallsstadium kein Bohrmehl ausstößt und somit keinerlei aüßere Anzeichen auf seine Anwesenheit hinterläßt. Oft frißt er sich nahe unter der Holzoberfläche durch und macht sich dort durch leise raspelnde Geräusche bemerkbar. Er befällt Nadelholz in Dachstühlen und seine Gefährlichkeit besteht darin, daß er durch das Abfressen des Splintholzes den Querschnitt des Holzes stark reduzieren kann. Das wiederum vermindert die statische Tragfähigkeit des Holzes da oft nur noch ein geringer Restquerschnitt des befallenen Holzes übrig bleibt. Seltener ist zu beobachten, daß auch das Kernholz von Hausbockfraßgängen durchzogen ist. Hier ist gleichzeitig ein Pilzbefall vorhanden, der das Kernholz wieder mit Eiweißstoffen anreichert und somit auch das Kernholz als Nahrungsgrundlage für den Käfer attraktiv macht.

Der "Gemeine Nagekäfer" (Anobium punctatum)
Der Gemeine Nagekäfer fällt durch kleine 1-2 mm große Bohrlöcher auf die sehr oft auch an Möbeln und Kunstgegenständen sichtbar sind. Das Bohrmehl rieselt aus den Löchern und bildet darunter kleine Mehlhäufchen. Treten diese Häufchen von selbst in größeren Mengen von slebst auf, kann dies ein Anzeichen für einen Lebendbefall sein. Die Häufchen werden hier hauptsächlich von anderen Insekten verursacht die sich von den Larven ernähren bzw. ihre eigene Brut in den Larven parasitär ablegen und dabei die Gänge freiräumen (sog. Predatoren wie der Blaue Fellkäfer, Spinnen oder betimmte Wespenarten).
Der Gemeine Nagekäfer richtet an Kunst- und Alltagsgegenständen großen Schaden an und ist auch sehr oft an hölzernen Bauteilen in Gebäuden anzutreffen. Wie der Hausbock beschränkt sich der gemeine Nagekäfer auf das Splintholz von Nadelhölzern. Seltener dringt er bis ins Kernholz vor. Er kann aber durch entsprechend starken Befall ebenfalls zu einer starken Querschnittsminderung der Bauteile beitragen.
Der "Gescheckte Nagekäfer" (Xestobium rufovillosum)
Der Gescheckte Nagekäfer ist ein Sekundärschädling, den man sehr oft in Eichenholz finden kann, aber auch in Nadelhölzern. Er findet sich nur in Hölzern,die bereits durch einen Pilzbefall vorgeschädigt und dessen Fasern sozusagen durch den Pilz "vorverdaut" sind. Die Bohrlöcher haben die Größe eines Stecknadelkopfs und sind kreisrund. Auch bei diesem Käfer kann der Befall tief bis ins Kernholz gehen.
Der "Trotzkopf" (Hadrobregmus pertinax)
Der Trotzkopf ist ebenso wie der Gescheckte Nagekäfer ein Sekundärschädling der von Pilzen vorgeschädigtes Holz benötigt.Im Gegensatz zum Gescheckten Nagekäfer befällt der Trotzkopf nur Nadelhölzer. Auch er bildet kreisrunde Ausfluglöcher mit einem Durchmesser von ca 2-3 mm Duchmesser.
Beide Arten, Trotzkopf und der Gescheckte Nagekäfer können den Abbau von Konstruktionshölzern zusätzlich zu den schon vorhandenen Baufäulepilzen stark beschleunigen.
Dies sind nur vier Beispiele von holzzerstörenden Insekten, es gibt eine Vielzahl weiterer Arten die sich auch durch weltweiten Handel mit Holz immer mehr in Mitteleuropa verbreiten.
Bei einer Bauuntersuchung muß prinzipiell festgestellt werden, ob es sich um einen aktiven Befall handelt oder um einen Altschaden. Auch die Insektenart und die Ausdehnung des Befalls sind für die weitere Vorgehensweise wichtig.
Ein Befall mit holzzerstörenden Insekten hat nichts mit unhygienischen Zuständen zu tun, die Insekten sind in natürlichem Ausmaß in der Umwelt vorhanden und nisten sich unter den für sie optimalen Umständen von selbst ein. Eine Bekämpfung des Schädlings durch einen zertifizierten Schädlingsbekämpfer ist daher nicht der einzige Schritt. Die Änderung der Bedingungen, die einen Neubefall begünstigen könnten, muß daher parallel angegangen werden.